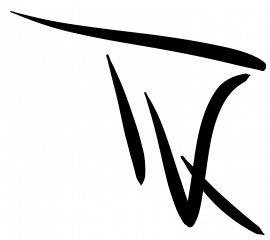Leseproben
Auswahl an Leseproben
Leseprobe 1
Aus: Privatbiografie, Lektorat
Politisch gesehen kommt mir die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg heute wie ein langer Waffenstillstand vor. Die Waffen ruhten nicht, überall auf der Welt wurde wieder hektisch aufgerüstet und mit Krieg gedroht. Der jahrzehntelange Kalte Krieg konnte jederzeit zu einem heißen werden. Dahinter stand das Gespenst eines weltweiten Atomkrieges, der vermutlich das Ende der menschlichen Zivilisation bedeutet hätte.
Der Weltkrieg hatte tiefe Spuren hinterlassen: zerstörte Häuser und Fabriken, ausgebombte Städte. Es gab viele umherziehende Obdachlose und Bettler, Millionen von Flüchtlingen mussten irgendwo untergebracht werden. So wurden im Dachgeschoss unseres Elternhauses das Ehepaar Radke, und in der primitiven Dachwohnung über unserer Garage die fünfköpfige polnische Familie Parowski einquartiert.
Wir Nachkriegskinder hatten keine unbeschwerte und sorglose Kindheit. Auch die zwei ältesten Geschwister, Georg und Elisabeth, kannten die Vorkriegszeit nur vom Hörensagen, sie waren ja damals noch Kleinkinder. Der Krieg lag nur wenige Jahre zurück, aber über dessen Brutalität wurde selten gesprochen, schon gar nicht in Anwesenheit von uns Kindern. Bei uns kamen immer nur Wortfetzen und Andeutungen von schrecklichen Ereignissen an. Wir spitzten die Ohren, konnten aber das Aufgeschnappte nicht in größere Zusammenhänge einordnen. Wenn wir uns mal zu fragen trauten, hieß es gleich: „Davon versteht ihr nichts. Das geht euch nichts an. Haltet mal gefälligst den Mund.“ – Originalton meiner Mutter. Kategorisch erklärte sie: „In der Familie redet man nicht über Politik“. Und mit Berufung auf ihren eigenen Vater – „der Kaiser war doch der Beste“ – war Schluss mit der Diskussion.
Unser Vater wurde erst in den letzten Kriegsmonaten eingezogen und dann sofort an die Ostfront geschickt. Dort geriet er auch gleich in russische Gefangenschaft und kam erst nach drei Jahren wieder zurück. Er war verstummt und schwieg sich weiterhin darüber aus. Auf die Frage, was er denn im Krieg gemacht habe, sagte er nur, er sei „bei den Maschinen“ gewesen. Zeitlebens war er traumatisiert, depressiv und pessimistisch. Für ihn gab es fortan nur eines: arbeiten, arbeiten, arbeiten, das Geschäft wieder aufbauen und die Familie ernähren.
Anders als ich erinnert sich mein Bruder Kalle noch heute genau an den Tag seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft – bezeichnenderweise war es der Erste Mai, der Tag der Arbeit: Unser Vater betrat sein Haus, bleich, abgemagert und die Haare geschoren. Über der Haustür hing eine grüne Girlande, in der Mitte ein Schild, darauf stand „Willkommen“. Der fünfjährige Knirps fragte: „Wer isch der fremde Mann?“
Leseprobe 2
Aus: Privatbiografie; Text & Gestaltung
„Meine ersten Kindheitserinnerungen sind fast ausnahmslos durch den Krieg geprägt. Ganz besonders erinnere ich mich an unseren Luftschutzkeller. Unser Haus lag ebenerdig zur Straße hin, aber im rückwärtigen Bereich gab es ein Untergeschoss. Dort befand sich eine Küche und der Keller, und der wurde zum Luftschutzkeller umfunktioniert. Der hieß nicht nur so, sondern er war mit einer schweren Eisentür versehen, die mit zwei Schieberiegeln verschlossen wurde.
Der Luftschutzkeller war nicht nur unser Zufluchtsort, auch die Nachbarn suchten dort Schutz. Ich erinnere mich daran, wie alle horchten und versuchten herauszufinden, welche Richtung die Flugzeuge einschlagen und wo sie ihre Bomben abwerfen würden. Dann hieß es „Die laden nicht hier ab, die fliegen rüber nach rechtsrheinisch“, aber oft genug täuschte man sich. Ich nahm die Angst wahr, die bei den Äußerungen der Erwachsenen mitschwang. Alle hatten Angst. Als Kind merkte man das.
Einmal wurden wir so schwer bombardiert, dass durch den Luftdruck die schwere Eisentür aufsprang, mitsamt den schweren Eisenriegeln, der aus der Verankerung im Mauerwerk gerissen wurden.
Eines Tages bombardierten sie das Sidolwerk, direkt in unserer Nachbarschaft. Da war Gerlinde schon geboren. Als die Sirenen das Ende des Luftangriffs signalisierte liefen wir schnell hinaus in den Garten und sahen das lichterloh brennende Fabrikgebäude. Man kann sich nicht vorstellen, wie das brannte, all die chemischen Substanzen, die dort lagerten. Meine Schwestern staunten über das „schöne Feuerwerk“. Sie waren noch so klein, dass sie nicht begriffen, was passiert war.
In solchen Situationen wurde mir bewusst, dass ich „die Große“ war. Nicht, dass man mir es nicht auch ständig gesagt hätte: „Du bist schon groß, Du bist schon tapfer, Du kannst das.“ Ich hatte zwei kleine Geschwister, aber meine Mutter hatte nur zwei Arme. Also gab es keinen Arm für mich, in den ich mich hätte flüchten können, und das hat mich bis heute geprägt.
(…)
Eine Zeitlang gab es eine ziemliche Rattenplage. Unten am Berg bei Richters stand eine Garage, dort hatten die Bauern zwei Ratten eingesperrt und ließen sie hungern. Sie fielen übereinander her und versuchten, sich gegenseitig aufzufressen. Sie kreischten wie kleine Kinder, es war entsetzlich. Doch es vertrieb die Ratten aus der ganzen Gegend, fortan wurden dort keine mehr gesehen.
Vor allem die Winter waren hart. Wir wohnten ja in einem Holzhaus, und nur im Wohnzimmer gab es eine Heizung. Wir froren ständig, und immerzu hatten wir Kinder nasse Füße. Ich erinnere mich gut, wie ich ständig an den Füßen fror. Doch wir waren weit weg vom Kriegsgeschehen, und das war die Hauptsache. Da jammerst Du nicht über kalte Füße. Unsere Füße durften wir nie an der Heizung wärmen, sondern mussten uns auf den Stuhl setzen und Wechselbäder machen. Ich weiß noch, wie ich mich fühlte, als ich meinen Kindern Jahrzehnte später Moonboots kaufte. Sie sollten niemals so kalte Füße wie ich damals haben.
Leseprobe 3
Aus: Judith Aßländer: „Die Mütter meiner Söhne“ (Arbeitstitel, erscheint voraussichtlich Anfang 2024); Lektorat & Schreibcoaching
Nach eineinhalb Stunden tatenlosem Warten verlasse ich das Hotel und gehe nervös die Straße auf und ab. Ich würde ihm gerne entgegengehen, aber ich weiß nicht einmal, wo sein Bus halten wird. Zwei Frauen sitzen in der Gasse vor dem Hotel und betteln. Sie sind noch jung, beide halten ein Baby im Arm. Ich frage mich, in was für einer ungerechten Welt wir eigentlich leben. Ich gebe beiden Geld und fühle mich schlecht dabei. Deprimiert und voller Sorge um Samir gehe ich zurück ins Hotel, setze ich mich auf mein Bett und warte.
Dann endlich eine Nachricht. Er nennt mir den Standort eines Cafés, das nur wenige Meter vom Hotel entfernt ist. Erleichtert antworte ich kurz und laufe los.
Ich sehe ihn schon vom Gehweg aus an einem Tisch am Fenster sitzen. Er strahlt mich an und ich bin froh, dass er unterwegs nicht kontrolliert oder verhaftet wurde. Wir fallen uns in die Arme. Ich bin erleichtert, einen lachenden jungen Mann vor mir zu sehen, der alles andere als vom Leben gebrochen zu sein scheint. Er sieht etwas älter aus als ich ihn in Erinnerung habe und er ist unrasiert, aber es scheint ihm gut zu gehen.
Nachdem er aus Deutschland nach Marokko zurückgekehrt war, hatten wir eine Zeitlang regelmäßig telefoniert, aber seit es ihn in die Türkei verschlagen hat, hatten wir kaum noch Kontakt. Kaum sitze ich, kommt ungefragt ein zweiter Kaffee, den Samir schon für mich bestellt hatte. Und als wäre es eines unserer üblichen Telefonate, schießt es gleich aus ihm heraus: „Und, Judith? Wie geht es dir? Der Familie? Den Kindern? Was machen all die anderen Jungs? Ist Jonas noch unterwegs? Ist Lukas wieder gesund? Arbeitet Peter noch in der Wohngruppe? Sind alle gesund?“
„Gut, auch gut, die Jungs studieren, arbeiten, gehen zur Schule, ja, Jonas ist gerade in Nepal, Lukas ist wieder gesund, Peter ist immer noch in der Wohngruppe”, antworte ich, und wir müssen beide lachen. Ich frage ihn nach seiner Mutter und seinem Bruder in Tanger. Er sagt, es ginge beiden gut. Sein Bruder hat nun einen Job in derselben Fabrik wie seine Mutter. Sie arbeiten hart, aber sie seien gesund. „Weißt du, Judith, Gesundheit ist das Wichtigste.“
Ja, da hat er sicher recht. „Und du, Samir?“, frage ich, „Wie geht es dir?”
„Mir geht es gut. Ich habe ein Bett, genug zu essen und Arbeit. Das ist okay.“
Das klingt okay, aber auch nur okay. Samir hatte mir Fotos von seinem Zimmer gesendet. Auf vielleicht zwölf Quadratmetern stehen zwei Stockbetten und in der Mitte ein kleiner Tisch. Ich frage genauer nach und er erzählt lachend, dass in den drei Zimmern derzeit siebzehn Menschen leben. Zwei Zimmer sind mit Marokkanern belegt, eines mit Syrern. Betten gibt es allerdings nur sechzehn, was bedeutet, dass in Samirs Zimmer immer einer auf dem Boden schlafen muss. Er lacht und erzählt, dass gerade zwei Jungs versuchen, nach Europa zu kommen. Das findet er super, weil nun jeder ein Bett für sich hat.
Was ihn aber nervt ist, dass einer seiner Zimmergenossen nicht arbeitet und fast nie das Zimmer verlässt. „Er schaut die ganze Nacht Filme oder telefoniert und lässt das Licht an. Da kann man nicht so gut schlafen.“
Ich versuche, mir das für mich vorzustellen und scheitere. Ich bin schon genervt, wenn Straßenlaternen in mein Zimmer scheinen oder mein Mann schnarcht.
Leseprobe 4
Aus: Nicolai Flöth: „Roadtrip zum Ich – Mit MS über Hollywood zum Schauinslandkönig“ (erscheint voraussichtlich Ende 2023); Lektorat
Meine zunächst vage Absicht wandelte sich allmählich zu einem realistischen Vorhaben, als ich das Training an der Strecke aufnahm. Nach den ersten Trainingseinheiten wuchs in mir die Zuversicht, nicht nur mit dem Verkehr, den Rasern und „Verkehrserziehern“ umgehen, sondern auch das erste, schwerste Stück bewältigen zu können.
Wie unglaubhaft, schon fast absurd mein Vorhaben nach außen hin erscheinen musste, wurde mir während meiner zweiten Trainingseinheit bewusst, als plötzlich eine Polizeistreife an meiner Seite auftauchte.
„Guten Morgen,“ begrüßte ich die Beamten mit einem freundlichen, fast amüsierten Gesichtsausdruck. „Was ist denn los?“
„Guten Morgen,“ entgegneten sie ebenso freundlich, nachdem sie wohl schnell erkannten, dass sie es nicht mit einem Verrückten zu tun hatten. „Jemand hat bei der Polizei angerufen und von einem Rollstuhlfahrer erzählt, der allein den Berg hinauffährt und womöglich auf der Flucht oder irgendwo ausgebrochen sei. Wir mussten der Sache nachgehen, um uns zu versichern, dass alles seine Richtigkeit hat.“
Auf die Erklärung meines Vorhabens hin, und dass sie bis zum Wettkampf zweimal wöchentlich mit solchen Anrufen zu rechnen hätten, reagierten die Beamten mit amüsiertem Verständnis und erkundigten sich nach ausreichender Flüssigkeitsaufnahme, da wir uns noch in der warmen Jahreszeit befanden.
Überhaupt schien mir das Wetter mehr als wohlgesonnen zu sein. Bei jeder Trainingseinheit wurde ich von Sonnenstrahlen motiviert und angetrieben. Zwischen den Trainingstagen hatten wir häufiger schlechtes Wetter, so dass ich mitunter an der planmäßigen Durchführung des nächsten Trainings zweifelte. Aber meine stetige Zuversicht und das Vertrauen darauf, dass ich trainieren könne, schienen mir Glück zu bescheren. Musste ich einmal ein Training verschieben, herrschte just am ursprünglich geplanten Tag schlechtes Wetter.
Es waren auch diese Umstände, die ich als Bestätigung für mein Vorhaben wertete und Gedanken an einen Rücktritt gar nicht erst aufkommen ließen. Es waren eher Begleiterscheinungen wie schlaflose Nächte aus Nervosität vor einer bevorstehenden Trainingseinheit, die mit großen Anstrengungen und Verschleißerscheinungen verbunden waren, die mich auf die Probe stellten.
Je näher das Rennen rückte, umso größer wuchs die Aufmerksamkeit, die mir zuteilwurde. Wie vereinbart begleitete mich auf meiner letzten Trainingseinheit das angekündigte Presseteam. Ein letzter Test mit einem anderen, von einem Sponsor zur Verfügung gestellten Rollstuhl fiel negativ aus, so dass ich auf meinen eigenen, schon vielfach auf Reisen und bei einem Marathon bewährten Rollstuhl zurückgriff.
Dann war der Wettkampftag gekommen.